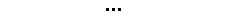Kleinkunst Straßentheater Kabarett Variete Circus
Agenturen Wettbewerbe Comedy Galas Festivals
- Titelstory [81 Artikel]
- Szenen Regionen [1145 Artikel]
- News Events [886 Artikel]
- Preise | Ausschreibungen [227 Artikel]
- Themen-Fokus [881 Artikel]
- Services | Tipps [142 Artikel]
- Bücher | CDs | Software [234 Artikel]
Szenen Regionen :: Berlin
[zurück]
Kritik: Noch einmal mit Gebiss
Reiner Kröhnert im Tränenpalast: „Sieben gegen Schröder“
Reden wir einmal über das Politkabarett. Es gibt ja noch Kabarettisten, die sich nicht in die Betrachtung des Privaten zurückziehen und auch nicht ins Comedyfach umsteigen wollen. Leute wie Reiner Kröhnert. Vor nicht allzuvielen Jahren war er ein Star der Szene, vor allem seine Politikerimitationen haben die Leute zum Grölen gebracht. Damals.
Heute ist politisches Kabarett marginaler denn je. Während eine Stimmenimitation des Bundeskanzlers in den Charts auf die Nummer Eins kommt wie neulich der „Steuer-Song“ der „Gerd-Show“. Gerhard Schröder kommt auch vor in Kröhnerts neuem Programm „Sieben gegen Schröder“. Direkt nach Friedrich Merz, Norbert Blüm, Hans-Dietrich Genscher, Angela Merkel, Rita Süssmuth, Erich Böhme und – warum eigentlich? – Boris Becker. Sie alle lässt er vor dem schlichten weißen Samtvorhang erscheinen, der das einzige Bühnenbild darstellt. Die Geschichte ist ambitioniert: Nobbi „Der Täufer“ Blüm schart eine murrende Jüngerschaft um sich, die den „rot-grünen Beelzebub“ in Berlin aus den Ämtern jagen will. Irgendwann gebiert Rita Süssmuth dann – warum eigentlich? – Klaus Kinski, Dani Cohn-Bendit taucht auch noch auf, es ist eine veritable und durchaus gelungene Leistungsshow des Parodisten Kröhnert, der in seinem weißen Anzug den Überblick über Stimmen und Körperhaltungen nie verliert und tatsächlich schnell vergessen macht, dass er allein auf der Bühne steht.
Das Publikum ist freundlich zugeneigt, der erste Szenenapplaus kommt nach der Pause bei einer Pointe gegen Roland Koch („Zehn Prozent weniger Hirn, und er wäre ein Fall für die Hundesteuer“). Das ist gar nicht so einfach im extrem unintimen Tränenpalast mit weit entferntem Publikum an einzelnen Tischchen. Dennoch bleibt am Schluss ein schales Gefühl. Warum das alles? Nicht nur, dass irgendwann der Eindruck entsteht, Kröhnert habe Uralt-Imitationen von Figuren reanimiert, bloß weil er sie beherrscht, obwohl sie jegliche politische Relevanz verloren haben. Auch wenn ihm einige gute Pointen gelingen, wirkt das ganze irgendwie in die Jahre gekommen.
Vielleicht ist das die ganze bittere Wahrheit: Viele Mittel der kabarettistischen Entlarvung findet längst im Mainstream statt und das mit gutem Biss. Nicht erst seit dem „Steuer-Song“. Vielleicht ist es angesichts des Einflusses, den die unpolitische Comedy auf das politische Kabarett genommen hat, einfach an der Zeit, dass sich die Altvorderen mal wieder was Neues einfallen lassen. Und vorher bitte den Sitz des Gebisses kontrollieren. Yeah.
Redaktion: Susann Sitzler