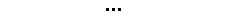Kleinkunst Straßentheater Kabarett Variete Circus
Agenturen Wettbewerbe Comedy Galas Festivals
- Titelstory [81 Artikel]
- Szenen Regionen [1145 Artikel]
- News Events [886 Artikel]
- Preise | Ausschreibungen [227 Artikel]
- Themen-Fokus [881 Artikel]
- Services | Tipps [142 Artikel]
- Bücher | CDs | Software [234 Artikel]
Szenen Regionen :: Köln-Bonn
[zurück]
„Von fremden Ländern und Menschen“
Prix Pantheon 2009 für Cloozy, Dave Davis und Dieter Hallervorden
Der Titel von Robert Schumanns Liedzyklus hätte das Motto für den diesjährigen Prix Pantheon sein können. Wieder fand sich die „Jugend der Welt“, so die rituelle Moderation Rainer Pauses, zum satirischen Wettkampf im Kabarett-Tempel an der ehemaligen Bonner Bannmeile ein. Sie kamen aus dem Morgenland, dem Norden und Osten Deutschlands, vom Niederrhein, von der Ruhr und aus Niederbayern. Die aus Lübeck stammende Stand-up-Komikerin und Musikerin Claudia Wipfler alias Cloozy, der in Köln geborene Kabarettist, Comedian und Musiker Dave Davis und der aus Dessau stammende Grandseigneur der öffentlich-rechtlichen Fernseh-Comedy, der Schauspieler Dieter Hallervorden, sind die Preisträger des Prix Pantheon 2009.
Der Prix Pantheon, einer der wichtigsten Kabarett-Preise der Republik, wurde wie jedes Jahr in vier Kategorien vergeben. An zwei Abenden (28. und 29. April) wetteiferten zwölf Kandidaten vor Publikum um den Jury-Preis der Kategorie „Frühreif und Verdorben“ und den Publikums-Preis der Kategorie „Beklatscht und Ausgebuht“. Bereits am Vorabend der Wettkampftage (27. April) war Dieter Hallervorden im Rahmen einer Gala mit dem Sonderpreis der Jury in der Kategorie „Reif und Bekloppt“ gekürt worden. Der Publikums- und der „Frühreif“-Preis sind mit jeweils 3.000 Euro, der Jury-Sonderpreis mit 4.000 Euro dotiert. Ab dem 9. Mai konnten die Zuschauer der Fernsehausstrahlungen der Wettkämpfe im WDR-Fernsehen über den ebenfalls mit 3.000 Euro dotierten TV-Publikumspreis der Kategorie „Klotzen und Glotzen“ abstimmen. Der Gewinner in dieser Preiskategorie stand bei Redaktionsschluss dieser TROTTOIR-Ausgabe noch nicht fest.
Den ersten Wettkampfabend eröffnete Serhat Dogan, der, glaubt man seinen Erzählungen, vor fünf Jahren als Militär-Drückeberger aus Izmir gekommen und seither der „einzige Türke mit Comedy-Visum“ in Deutschland ist. Dogan ist blond, blauäugig und leicht untersetzt. Mit sanfter Stimme referiert er die Lebensregeln des türkischen Machos („Macho muss immer Kontrolle haben.“) und droht ab und zu in freundlichem Ton: „Wartet nur, bald sind wir in der EU!“ In vordergründig naivem Ton liest er aus „Serhats Tagebuch“ seine Erlebnisse in München, Dresden, Bitterfeld und Hoyerswerda vor: „Menschen hier nicht so gesund. Viele sind noch jung, aber haben schon alle Haare verloren. Aber treiben viel Sport. Tragen alle Baseballschläger.“ Dogan präsentiert, und das mag ein Widerspruch in sich sein, nachdenkliche Comedy. Scheinbar naiv, mit aufgerissenen Kulleraugen, trifft er gesellschaftliche Probleme präzise und leicht unter der Oberfläche. Er krönt seinen parlierenden Auftritt mit der Parodie auf den Tanz eines ‚türkischen Machos‘ in der Disco nach „zehn Bier“: Bauchtanz, voller Körpereinsatz, Ekstase beim Publikum.
Heino Trusheim, gebürtig aus dem niederrheinischen Moers, übernimmt den Stab vom Eröffnungsauftritt des ersten Abends: „Kaum ist der Ausländer weg, schon steht eine Glatze auf der Bühne“. Er scheut dort vor nationalen Stereotypen nicht zurück – etwa, indem er auf ein Fußball-EM-Spiel zwischen der Schweiz und der Türkei eingeht, bei dem es zu Ausschreitungen gekommen war und die Parteigänger der Mannschaft vom Bosporus den Eidgenossen anschließend Provokationen vorwarfen. Trusheim dazu: „Wer ist nicht schon mal abends in der Disco von einem Schweizer provoziert worden?“ Liebenswert sind seine Witze, wenn es um deutsche oder französische Schrullen geht. Seine „Starbucks“-Satire (der endlose Coffee-to-go-or-not-Varianten herunterrasselnde Angestellte und der hoffnungslos überforderte Mittdreißiger, der eigentlich nur einen Kaffee wollte) erscheint im ersten Moment wie ein „No-Go“, ist aber originell extemporiert.
Der Norden (vom Rheinland aus gesehen) brachte auch Katinka Buddenkotte hervor, und auch sie schürft in liebenswerten und altbekannten Stereotypen. Buddenkotte liest als „Fräulein-Wunder der Untergrund-Literatur“ aus ihren Erinnerungen an eine Kindheit in Münster, als Kind aus ihren jeweiligen Kirchen ausgetretener Eltern, das mit acht auf einmal vor dem Essen beten wollte. Heute wünscht sie sich, den Mann zu finden, der mit ihr eine Tankstelle ausraubt, und parodiert respektlos die Erzähl- und Erschütterungsmuster des französischen Autorenfilms.
Volker Strübing, geboren in Thüringen, aufgewachsen in Sachsen-Anhalt und Berlin-Marzahn und Gewinner von Poetry-Slams 2005 in Leipzig und 2006 in München, ist ein junges, frisches, sympathisches Gesicht. Er komme gern nach Bonn, eröffnet er seinen Auftritt, weil er hier merke, was er an Berlin habe. Er erklärt, er sei froh, dass es dem Pantheon besser ergangen sei als dem Palast der Republik, und beginnt dann aus seiner Kladde vorzulesen. Ein wenig erinnert sein Auftritt an den von Spider Krenzke im vergangenen Jahr beim Prix Pantheon (TROTTOIR berichtete). Nur dass Strübing diese gewisse kompromisslose, proletarische und gnadenlos intelligente Dämonie fehlt. Dafür ergeht er sich in schwarzem Humor und in Liedern zur Gitarre über die neudeutsche Beziehungs- und Kleinfamilien-Kultur („Café Pregnant“ und „Bastelt das Holocaust-Mahnmal“ als ‚Arbeitsauftrag‘ für die Kleinen beim Kindersitten).
Cloozy, die Preisträgerin der Jury, steht als eine Kreuzung aus Hausfrau in mittleren Jahren und Filmdiva der Fünfziger auf der Bühne: Schwarze Stoffhose, geblümte Bluse, ondulierte Frisur, Hornbrille und eine Perlenkette mit Knoten. „Mein Name ist Helga Raspel und mein Hobby sind blickdichte Blusen.“ So stellt sie sich vor. In ihrer Bühnenrolle ist sie die Vorstandssekretärin, die von ihrem Yuppie-Chef und seiner Gattin mit den beiden Söhnen (Humphrey und Bogart) und dem Jack-Russell-Terrier im Mercedes ins Wochenende mitgenommen wird, die übers Internet-Dating einen Mann kennengelernt hat, dem sie „in anatolischer Freundschaft, oder wie das heißt“ verbunden ist und die von der Firma in die Werkshalle vorgeschickt wurde, um den Jungs am Band die Kündigungen auszuhändigen, bis sie mehr oder weniger nur noch allein mit ihrem Chef im Unternehmen war. Cloozy steht, Standbein, Spielbein, in der Hüfte leicht verdreht, leicht vorgebeugt und fährt immerzu mit der einen Hand an ihrer Perlenkette mit dem Knoten auf und ab, während sie in Hamburger Tonfall einen „stöhrschen Versprecher“ nach dem anderen produziert. Karoline Stöhr, die Gattin eines Fischhändlers in Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“, die ständig unfreiwillig komisch Wörter verballhornt, sagt „Erotika“ anstatt „Eroica“, wenn sie Beethovens 3. Symphonie meint. Helga Raspel spricht von „anatolischer Freundschaft“ und sagt „nicht gut in Ornithologie“, wenn sie eine Rechtschreibschwäche meint. Dann ahmt sie virtuos Vogelstimmen und Modem-Einwahlen auf ihrer Violine nach und verabschiedet sich vom hingerissenen Publikum mit den Worten: „Ja, ich dank Ihn’ dann für Ihr Vertrauen, Kommata, Ihre Helga.“ Und der ganze Saal hat Cloozy ins Herz geschlossen.
Den ersten Abend des Wettbewerbs beschloss Carmela de Feo alias La Signora. Wie eine Erscheinung aus einer Fellini-Fantasie steht sie auf der Bühne: Schwarze Bluse, schwarzer Dutt, Brosche am hochgeschlossenen Kragen, schmales Gesicht, klein, drahtig. In Carmela del Feo paart sich herzhafter Oberhausen-Altstadener Humor mit der Erscheinung einer italienischen Signora. Sie spielt Akkordeon wie ein Kirmes-Musikant und fährt das Publikum an: „Ich krieg grad Gefühle, merkste?“ Ihre Parodie auf den Hit „Wir sind vom selben Stern“ des Duos „Ich und Ich“ (Annette Humpe, Adel Tawil) mit dem Refrain: „Ich will ein Kind von dir! (Glückauf!)“ laviert zwischen Anspielungen auf erotische Obsessionen, robustem Ruhrpott-Humor und ehrlicher Sentimentalität. Was an der Stadt nördlich von Mülheim an der Ruhr strukturell schwach war, macht La Signora mit ihrem Temperament wieder fett.
Ein weiteres Beispiel für die künstlerische und anarchische Urkraft der Provinz ist der wie Carmela de Feo aus Oberhausen (Stadtbezirk Sterkrade, Stadtteil Schmachtendorf) stammende Matthias Reuter. Reuter: Das ist ein Mann und sein Klavier. Im bürgerlichen Leben unterrichtet er an der Oberhausener Musikschule. Auf der Bühne spielt er virtuos die Titelmelodie aus „Ein Fall für Zwei“ („Wollte nur mal sehen, ob das Klavier noch geht.“), parliert leichthin über den Umgang mit der täglichen Katastrophenberichterstattung („1.: Ein Unglück kommt selten allein. 2.: Wat willste machen?“) und bezaubert das Publikum mit flotten Erzählchansons über Alltagserlebnisse, verpackt in hochartifizielle und dabei so schlicht klingende klassische Liedstrukturen und Strophenformen. Reuter gibt Beiträge zur soziologischen Konfliktforschung aus dem „Kosmos Ruhrgebiet“ zum Besten und spielt eine kleine Szene hysterischer Terrorangst im ICE vor, immer sich selbst am Klavier begleitend. Hinter der harmlos erscheinenden Maske des Oberhausener Musikschullehrers verbirgt sich ein Vertreter der wohl deutschesten aller Kunstrichtungen: der Romantik. Von Reuters Kunst wünscht man sich abendfüllende Programme auf vielen Bühnen.
Nepo Fitz kommt vom Land, aus Eggenfelden – auch ein Schicksal. Und er geht das Publikum direkt beleidigt an, für den Fall, dass es nicht über seine Scherze lache. „Das ist Humor in Niederbayern“, erklärt er, „da komm’ ich her.“ Er erklärt die Grundpfeiler der niederbayerischen Folklore. Wichtig seien für die Adoleszenz dortselbst: erstens der erste Vollrausch, zweitens der Führerschein und der Verlust desselben wegen Fahrens im Rausch. Er unterhält das Publikum mit der Nachahmung einer Drive-In-Bestellung im tiefsten Dialekt seiner Heimat, Erlebnissen mit dem Türsteher Hansi und Live-Schnipseln aus dem Provinz-Fitness-Studio. Dann setzt er sich ans Klavier, erzählt satirisch vom Schüleraustausch-Aufenthalt im pennsylvanischen Mannheim, aus dem er das Fazit gezogen habe: „Landleben ist überall gleich“, setzt sich zwei Schirmkappen auf, parodiert „Extreme Hip-Hop“ und beschließt seinen Auftritt mit dem Rock’n’Roll-Song „Great Balls of Fire“. Fitz Auftritt ist eine professionelle Mischung aus Provinz-Kabarett und Musik. Der junge Mann ist fotogen, agil, hat bereits eine Reihe von regionalen Kabarett-Preisen gewonnen, und es wäre nicht verwunderlich, wenn er bald vom Fernsehen für eine breitere Öffentlichkeit entdeckt würde.
Das Kölner Damentrio Fönfieber tritt in glamourösem Fummel und mit lustigen Schwimmringen um die schlanken Taillen auf. Schon beim Hereinkommen bezaubern die Damen mit gekonntem A-Capella-Gesang. Ihre Geschichte: Sie sind Agentinnen, die James Bond beschützen. In dieser Mission singen und spielen La Chiffre (Barbara Gescher, Klavier und Percussion), Schmidt (Anja, Oboe und Englisch Horn) und Weyers (Britta, Fön, Gesang und Ukulele) ein Repertoire von James-Bond-Film-Titelliedern und anderen Songs. Durch die Bühnenfiguren von Fönfieber schimmert die reale Existenz dreier attraktiver, begabter und musikalisch exzellent ausgebildeter Frauen, nicht zuletzt auf dem hart umkämpften Playground der Kölner Medien- und Kleinkunstszene. Die Fantasie, Beschützerinnen des Über-Machos James Bond zu sein, jenes einen Mannes, der „selbst im hellblauen Frottee-Bademantel noch unverschämt gut aussieht“, ist nur scheinbar lustig und unter der Oberfläche bitterernst – wie jedes gute Kabarett. Die Idee für Fönfieber – Parodien auf James-Bond-Songs, eingepackt in die Rahmenerzählung jener drei Agentinnen – ist schön, trägt aber noch nicht allein als überzeugendes Kleinkunst-Konzept.
Der Gewinner des diesjährigen Publikumspreises, Dave Davis, tritt als Kunstfigur Motombo Umbokko aus Mfudu konsequent politisch unkorrekt auf. Als Toilettenmann in einer Filiale eines Schnellrestaurants und Asylbewerber, der aus Mfudu flüchtete, nachdem sein Onkel Mandingo Umbokko, Journalist und Chefredakteur der „Geschwätzigen Antilope“, dort einen großen Wahlbetrug des Präsidenten Tsugabe aufgedeckt habe, zieht Davis über deutsche Asylpolitik, deutsche Befindlichkeiten und Absurditäten her. Der in Köln geborene und in Bonn lebende Comedian ergeht sich in einem ‚afrikanischen‘ Akzent und gibt, die rechte Hand auf den Schrubberstiel und die linke in die Hüfte gestützt, wenn er sie nicht zum sparsam eingesetzten Gestikulieren braucht, Weisheiten seines stummen Opas zum Besten wie: „Zu viel Brei verdirbt den Koch“ und „Der fette Vogel bricht den Ast.“ Er erzählt von der herzlichen Zuneigung der Restaurant-Mitarbeiterin Bettina aus „Dunkel-Deutschland“, traumatischen Erfahrungen mit der Gründung eines Fußpflegesalons in der Kölner Ehrenstraße und der Freundschaft zum Baufacharbeiter Beton-Micha mit dem ADS-kranken Dackel Hilti. Davis Pointen sitzen, jede Kunstpause stimmt, und das aufs Beste amüsierte Saalpublikum wählte ihn zum Favoriten der beiden Abende.
Nils Heinrich aus Sangerhausen bei Halle tritt mit Understatement auf. Leise missmutig zieht er über die „Krise“ her. Mit schlichten Liedern zur Gitarre verbreitet er die Melancholie und den leisen Zynismus eines, der bereits einen Systemzusammenbruch erlebt hat und nun die Bankenkrise und ‚Geld, das weg ist‘ mit ansehen muss. Abgestoßen und enttäuscht schildert er, wie der Arkadenwahn neuer städtischer Architektur, das neudeutsche Schlager-Elend und – vor allem – Bionade-Trinker ihm die letzten Illusionen über den Kapitalismus geraubt haben. Die politisch und ökologisch angeblich korrekte Limonade, „Ablasshandel in Flaschen“, sei in Wirklichkeit abgelaufener, saurer Raketentreibstoff von der NASA, „damit wir weiter an die Mondlandung glauben.“ Eine von Heinrichs Behauptungen stimmte nicht: Dass er nach Dave Davis Auftritt „blass“ wirken werde. Seine Kunst war wohl zu ernst und zu subtil für den Publikumspreis.
Der böseste, abgründigste und am respektlosesten mit Tabus umgehende Auftritt der zwei Abende kam von Oliver Polak. Polak ist Jude, depressiv und stammt aus Papenburg. Untersetzt, in schwarzer Windjacke mit Kunstfellkragen erklärt er dem Publikum, es müsse trotzdem nur lachen, wenn es ihn komisch finde. Dann erzählt er Witze über die jüdische und jiddische Lebenswelt. Polaks Grenzverletzungen sind präzise, kalkuliert, gehen nie zu weit, erreichen aber zumeist eines: dass den Zuschauern das Lachen im Halse stecken bleibt. Immer wieder führt er sie aufs Glatteis, etwa mit dem „Judenspiel“. Er fordert das Publikum auf, zu Namen, die er nenne, jeweils in den Saal zu rufen, ob der Träger Jude oder „normal“ sei. Das Publikum ertappt sich selbst dabei, dass es bestimmte Verhaltensstereotypen auf eine vermeintlich jüdische Identität zurückführt. Polaks Angebot: „Ich vergesse die blöde Geschichte mit dem Holocaust. Ihr verzeiht uns Michel Friedman“, entlarvt die Grenzen der Comedy und so etwas wie die unterschwellige Obszönität des Kabaretts. Polaks Auftritt war wohl zu ernst, um mit einem Preis bedacht zu werden.